|
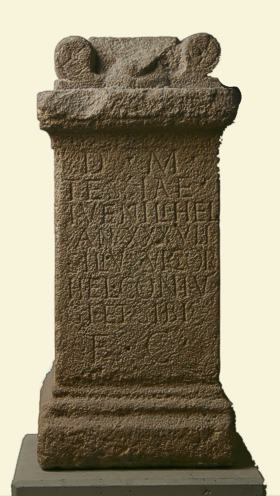 Die antiken Städte waren, nicht anders
als die heutigen, Schmelztiegel verschiedener Ethnien und eine
Ansammlung verschiedener sozialer Schichten. In Trier lebten
neben den einheimischen Adeligen aktive und ausgeschiedene Militärs,
zugezogene Beamten und Zivilisten sowie die einfachere Bevölkerung,
Freigelassene und zahlreiche Sklaven zusammen. Mit der Besetzung
des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg ab ca. 45/50
n. Chr. wurde ein zu dieser Zeit kaum besiedeltes Gebiet
Teil des Imperium Romanum. Archäologisch lässt sich
keine nennenswerte einheimische Bevölkerung nachweisen – nach
heutigem Forschungsstand brach die keltische Besiedlung im Laufe
des 1. Jahrhunderts vor Christus bis auf wenige Fundpunkte am
Hochrhein und in der Bodenseeregion ab. Im Oberrheintal und im
Mündungsgebiet des Neckars um Ladenburg und Heidelberg siedelten
kleinere Gruppen von Germanen aus dem elbgermanischen Kulturkreis – die
so genannten Oberrheingermanen und Neckarsueben, die in der ersten
Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus
mit Billigung Roms zugezogen waren. Die antiken Städte waren, nicht anders
als die heutigen, Schmelztiegel verschiedener Ethnien und eine
Ansammlung verschiedener sozialer Schichten. In Trier lebten
neben den einheimischen Adeligen aktive und ausgeschiedene Militärs,
zugezogene Beamten und Zivilisten sowie die einfachere Bevölkerung,
Freigelassene und zahlreiche Sklaven zusammen. Mit der Besetzung
des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg ab ca. 45/50
n. Chr. wurde ein zu dieser Zeit kaum besiedeltes Gebiet
Teil des Imperium Romanum. Archäologisch lässt sich
keine nennenswerte einheimische Bevölkerung nachweisen – nach
heutigem Forschungsstand brach die keltische Besiedlung im Laufe
des 1. Jahrhunderts vor Christus bis auf wenige Fundpunkte am
Hochrhein und in der Bodenseeregion ab. Im Oberrheintal und im
Mündungsgebiet des Neckars um Ladenburg und Heidelberg siedelten
kleinere Gruppen von Germanen aus dem elbgermanischen Kulturkreis – die
so genannten Oberrheingermanen und Neckarsueben, die in der ersten
Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus
mit Billigung Roms zugezogen waren.
Auch wenn sich die Amtsträger in ihrer offiziellen Rolle
stets mit Toga darstellen ließen, so wurde die Toga selbst
von Männern mit Bürgerrecht sicher nur selten angezogen;
das meterlange Stoffgewand, welches aufwendig um den Körper
drapiert wurde, war kaum alltagstauglich.
|
 Gerade
aus den Provinzen mit einem hohen Anteil keltischstämmiger
Bevölkerung ist bekannt, dass der so genannte gallische
Kapuzenmantel, ein ponchoartiges Kleidungsstück äußerst
beliebt war. Da der Kapuzenmantel bei nasser und kalter Witterung
gut warm und trocken hielt, ließ Kaiser Caracalla gar seine
Soldaten damit ausrüsten. Eine als „Treverermännchen“ bekannte,
in Trier gefundene Bronzestatuette, zeigt einen Mann in dieser
typisch keltischen Tracht: Gamaschen um die Unterschenkel und
Schnürschuhe vervollständigen das Allwetter-Outfit.
Zur Zeit der Römer setzte sich die Bevölkerung im zivilen
und militärischen Bereich aus einem bunten Gemisch zusammen:
Zu einem großen Teil handelte es sich um Kelten aus Gallien,
jedoch sind auch Bewohner aus anderen Regionen des Reiches nachgewiesen,
etwa aus Nordafrika, aus Britannien oder Spanien. Gerade
aus den Provinzen mit einem hohen Anteil keltischstämmiger
Bevölkerung ist bekannt, dass der so genannte gallische
Kapuzenmantel, ein ponchoartiges Kleidungsstück äußerst
beliebt war. Da der Kapuzenmantel bei nasser und kalter Witterung
gut warm und trocken hielt, ließ Kaiser Caracalla gar seine
Soldaten damit ausrüsten. Eine als „Treverermännchen“ bekannte,
in Trier gefundene Bronzestatuette, zeigt einen Mann in dieser
typisch keltischen Tracht: Gamaschen um die Unterschenkel und
Schnürschuhe vervollständigen das Allwetter-Outfit.
Zur Zeit der Römer setzte sich die Bevölkerung im zivilen
und militärischen Bereich aus einem bunten Gemisch zusammen:
Zu einem großen Teil handelte es sich um Kelten aus Gallien,
jedoch sind auch Bewohner aus anderen Regionen des Reiches nachgewiesen,
etwa aus Nordafrika, aus Britannien oder Spanien.
Biografische Details einzelner Stadtbewohner erfahren wir aus
Grabinschriften, aber auch aus Skulpturen und Porträts.
So berichtet ein Grabstein aus Rottenburg vom Tod der Ehefrau
des Silius Victor. Er musste Tessia Iuvenilis mit 37 Jahren zu
Grabe tragen. Beide legten anscheinend Wert auf ihre Zugehörigkeit
zum keltischen Stamm der Helvetier, denn dies ließen sie
in der Inschrift ergänzen.
Steinerne Statuen von Kindern wurden in einem Tempelbezirk vor
den Toren Triers gefunden. Da die Kindersterblichkeit in der
Antike hoch war, stiftete man Statuen von Kindern, um den Schutz
der Götter zu erbitten. Eine Beobachtung ist dabei besonders
interessant: Bei den Gräbern finden sich mehr Knaben- als
Mädchenstatuen. Dies gilt als Indiz dafür, dass männlichen
Nachkommen mehr Wertschätzung entgegengebracht wurde. Beeindruckend
sind auch die Porträts von Grabdenkmälern der Oberschicht,
die sich in Trier vielfach erhalten haben. Nicht nur der Familienvater,
der Pater familias, und seine Familie wurden dargestellt, sondern
auch die verdiente Dienerschaft, wie das Porträt eines Mannes
mit Hasenscharte zeigt. Bezeichnend ist hier die Hasenscharte,
denn die Darstellung von körperlichen Gebrechen war für
Angehörige der Elite nicht üblich. |