|
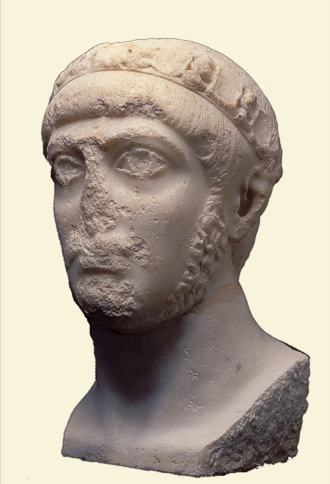 Germaneneinfälle, häufige Regierungswechsel, Gegenkaiser,
Kriege im Osten und eine Inflation stürzten das Römische
Reich im 3. Jahrhundert nach Christus in eine schwere Krise,
von der das rechtsrheinische Gebiet besonders betroffen war.
Soldaten wurden vom Limes abgezogen, daher war die Sicherung
der Grenze nicht mehr möglich. Ab 233 nach Christus sind
Einfälle von später als Alamannen bezeichneten germanischen
Stammesgruppen zu verzeichnen, zudem bestand eine wirtschaftlich
prekäre Lage. Die Zivilbevölkerung sah sich gezwungen,
das Gebiet nach und nach zu verlassen. Um 270 nach Christus zog
sich Rom endgültig hinter Rhein, Iller und Donau zurück,
Städte und Siedlungen verödeten vollständig. Sie
wurden von den Germanen, die sich in der Folge in dem Gebiet
niederließen, nicht weitergenutzt. Germaneneinfälle, häufige Regierungswechsel, Gegenkaiser,
Kriege im Osten und eine Inflation stürzten das Römische
Reich im 3. Jahrhundert nach Christus in eine schwere Krise,
von der das rechtsrheinische Gebiet besonders betroffen war.
Soldaten wurden vom Limes abgezogen, daher war die Sicherung
der Grenze nicht mehr möglich. Ab 233 nach Christus sind
Einfälle von später als Alamannen bezeichneten germanischen
Stammesgruppen zu verzeichnen, zudem bestand eine wirtschaftlich
prekäre Lage. Die Zivilbevölkerung sah sich gezwungen,
das Gebiet nach und nach zu verlassen. Um 270 nach Christus zog
sich Rom endgültig hinter Rhein, Iller und Donau zurück,
Städte und Siedlungen verödeten vollständig. Sie
wurden von den Germanen, die sich in der Folge in dem Gebiet
niederließen, nicht weitergenutzt.
Allerdings hatten auch die Alamannen ihren Traum von Rom: Gerade
in Gräbern der frühen Siedler finden sich neben Objekten
aus ihrer alten Heimat auch viele römische Güter. Diese
waren hoch begehrt und wurden entweder in den von den Römern
verlassenen Siedlungen und Städten gefunden, durch Warenaustausch
erworben oder aber von Raubzügen in das römische Gebiet
jenseits des Rheins als Beute mitgebracht. Schöne Beispiele
hierzu gibt es in der Ausstellung aus Lauffen a. N. und Gundelsheim.
Während das Gebiet rechts des Rheines aufgeben wurde,
erlebte Trier eine ungeahnte Blüte: Im Jahre 286 nach Christus
wurde Trier Residenzstadt eines in zwei Verwaltungsgebiete neu
aufgeteilten
Reiches, mit einem östlichen und einem westlichen Reichsteils.
Als Verwaltungssitz für den gesamten Westen des Römischen
Reiches reichte ihr Einfluss von Britannien im Norden bis Marokko
im Süden. Binnen weniger Jahrzehnte wurde eines der größten
kaiserlichen Bauprogramme zur Repräsentation des neuen römischen
Zentrums der Macht umgesetzt. Trier wurde zur Roma Secunda,
dem zweiten Rom, und zur größten Stadt nördlich
der Alpen.
Ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts setzte aufgrund
der zunehmenden Bedrohung durch die Germanen eine allmähliche
Abwanderung der Bevölkerung ein. Zeichen dieser Zeit ist
die Verödung ganzer Stadtviertel und die Ausbeutung der
ehemals glanzvollen Ausstattung.
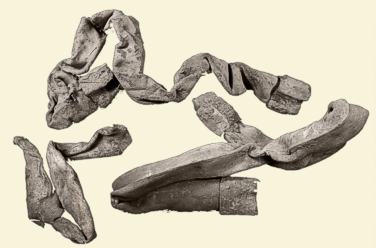 Bilder:
Porträt des römischen Kaisers Gratian mit
zerstörtem Gesicht.
Trier, 2. Hälfte 4. Jh. n. Chr. (oben) Bilder:
Porträt des römischen Kaisers Gratian mit
zerstörtem Gesicht.
Trier, 2. Hälfte 4. Jh. n. Chr. (oben)
Zerstörte Bleirohre vorbereitet zum Einschmelzen.
Trier, aus der Mosel, 2.–4. Jh. n. Chr. (unten)
Beide Rheinisches Landesmuseum Trier. ©
Th. Zühmer; Rheinisches Landesmuseum Trier
Marmorne Wandverkleidungsplatten
wurden als Inschriften wiederverwendet, marmorne Bildwerke mit
Darstellungen aus der Mythologie – angesichts der Dominanz
des Christentums ohnehin bedeutungslos – wurden zerschlagen,
um im Ofen zum Kalk verbrannt zu werden. Bronzene Standbilder,
lange schon als Nistplätze von Vögeln genutzt, wurden
zerschnitten und zur Wiederverwendung des Metalls eingeschmolzen.
Auch den Römern war Recycling nicht unbekannt. Mit der Übernahme
durch Franken und Germanen im 5. Jahrhundert nach Christus endet
das städtische Leben in einer nahezu intakten römischen
Metropole wie Trier – aus der Traum! Der Traum von Rom
fand sowohl in Trier als auch im heutigen Baden-Württemberg
trotz aller Unterschiede ein jähes Ende: Geblieben ist die
Vielzahl von archäologischen Funden, Gebäuderesten
oder gar oberirdisch noch sichtbaren Bauten. Sie alle lassen
uns auch nach rund 2000 Jahren noch die Sehnsucht der Bevölkerung
in den Provinzen erahnen und vermitteln einen Eindruck davon,
wie das Vorbild Rom Alltag und Leben bestimmte. |