| |
|
Nicht nur in Sachen Architektur und Lebensart eiferte man dem
großen Vorbild nach, sondern auch in Verwaltungsangelegenheiten.
Von der Verwaltung eines jeden Gemeinwesens bis zur Hierarchie
der Beamtenschaft - Rom war die alles beherrschende Größe.
Die Strukturen deckten sich weitgehend in den Provinzstädten
mit denen der Reichshauptstadt. So standen etwa in Rom zwei
consules als höchste Beamte der Verwaltung vor, die Beschlüsse
fasste der Senat. In den Provinzen entsprachen diesen die so
genannten duoviri (wörtlich: Zwei-Männer) und der
Rat der decuriones. Unterstützt wurden sie von den Magistraten,
deren Amtszeit jeweils ein Jahr dauerte.
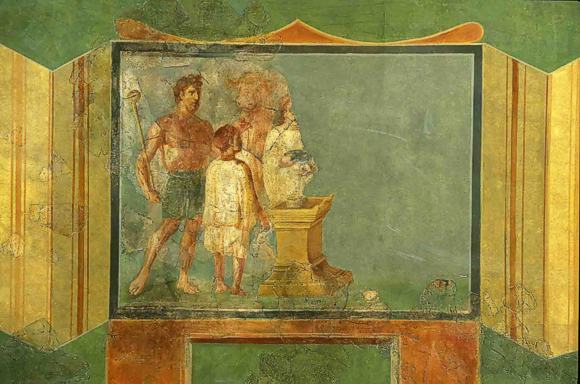
Wandmalerei mit Stieropfer.
Trier, Palastgarten,
2. Jh. n. Chr.
Rheinisches Landesmuseum Trier. ©
Th. Zühmer; Rheinisches Landesmuseum Trier
Stadt, Prestige, Wohlstand – dieser
Dreiklang bestimmte die römische Lokalpolitik. Die Übernahme
eines Amtes als Magistrat war Ehrensache, eine Bezahlung gab
es nicht. Im Gegenteil, man musste selbst große Summen
dafür aufbringen, etwa zur Finanzierung des Verwaltungsapparats.
Trotz des hohen finanziellen Eigenaufwandes waren die Ämter
sehr begehrt, denn brachten sie auch kein finanzielles Zubrot,
so ließen sie das Prestige sprunghaft wachsen. Besonders
vor den Wahlen rang man um die Gunst der potenziellen Wähler,
was ebenfalls eine kostspielige Angelegenheit war und ebenso
aus eigener Tasche finanziert werden musste. Wählen durfte
nicht jeder, dennoch kann die römische Gesellschaft als
sehr offen bezeichnet werden: so konnte zum Beispiel der Aufstieg
von freigelassenen Sklaven zu römischen Bürgern innerhalb
einer Generation gelingen. Auch Nichtrömer, das heißt
Personen ohne römisches Bürgerrecht, erhielten die
Chance, Ämter und Prestige zu gewinnen.
|
 Die
Selbstdarstellung und Repräsentation spielte für
alle Personen des öffentlichen Lebens eine große Rolle.
Dafür entwickelten die Römer eine ausgefeilte Bildsprache,
die eher einem Spiel mit Symbolen entsprach. Das bevorzugte Medium
der Antike war die Plastik. Es kam darauf an, sein Bild auf öffentlichen
Plätzen und in Heiligtümern aufzustellen. Als Gewand
kam nur eine Toga, das Kleidungsstück eines Vollbürgers,
in Frage. Da nur Personen mit vollem römischem Bürgerrecht
die Toga tragen durften, war die Darstellung als Togatus an sich
ein Privileg (Bild links: Statue eines Togatragenden (Togatus).
Möhn (Kreis Trier-Saarburg), Tempelbezirk,
1. Hälfte 2. Jh. n. Chr. Die
Selbstdarstellung und Repräsentation spielte für
alle Personen des öffentlichen Lebens eine große Rolle.
Dafür entwickelten die Römer eine ausgefeilte Bildsprache,
die eher einem Spiel mit Symbolen entsprach. Das bevorzugte Medium
der Antike war die Plastik. Es kam darauf an, sein Bild auf öffentlichen
Plätzen und in Heiligtümern aufzustellen. Als Gewand
kam nur eine Toga, das Kleidungsstück eines Vollbürgers,
in Frage. Da nur Personen mit vollem römischem Bürgerrecht
die Toga tragen durften, war die Darstellung als Togatus an sich
ein Privileg (Bild links: Statue eines Togatragenden (Togatus).
Möhn (Kreis Trier-Saarburg), Tempelbezirk,
1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.
Rheinisches Landesmuseum Trier). Als standesgemäßes
Accessoire trug der Dargestellte häufig eine Schriftrolle
in der Hand oder ließ sich
mit einem Behälter für Schriftrollen zu seinen Füßen
abbilden – dies galt als Hinweis auf das hohe Bildungsniveau
des in Stein verewigten Amtsträgers. Die Statue eines Togatus
aus dem Heiligtum in Möhn, in der Nähe von Trier, gibt
einen kleinen Einblick in die Raffinessen der römischen
Bildsprache. Auch Weihungen an Gottheiten konnten den eigenen
Zwecken dienen. Sie wurden nicht alleine aus religiösen
Motiven gestiftet, sondern machten zugleich Werbung für
die eigene Amtszeit. Nicht nur der Name des Stifters, sondern
auch dessen Amt wurde prominent in der zum Weihgeschenk gehörenden
Inschrift platziert. Inschriftensteine finden sich heute vergleichsweise
häufig – zum Glück! Denn sie liefern Archäologen
wichtige Hinweise zur Verwaltung in den Provinzstädten.
„Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein“,
so drückt ein in Deutschland gebräuchlicher Spruch
die Beliebtheit des Vereinswesens überspitzt aus. Das galt
auch schon für die Römer: „Tres faciunt collegium – Drei
machen ein Kollegium“, ein Rechtsspruch, der besagt, dass
ein Verein mindestens drei Personen umfassen musste. Solche Zusammenschlüsse
spielten im öffentlichen und religiösen Leben der Römer
eine tragende Rolle. Es gab sie in allen Bereichen der Gesellschaft
einer Stadt, so wissen wir zum Beispiel von der Berufsvereinigung
der Feuerwehrleute im römischen Trier. Andere Vereine wiederum
widmeten sich den vielfältigen öffentlichen und religiösen
Belangen, wie der Verehrung des Kaisers und der Kultausübung.
In Neuenstadt am Kocher gab es einen Verein junger Männer,
der diese auf ihre Zukunft als kommunale Leistungsträger
auf die Karriere vorbereitete. |
|