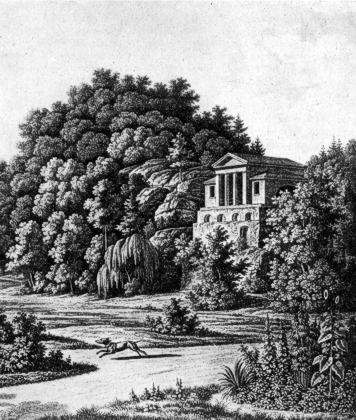| Schloss und Landgut Rotenfels haben ihren Ursprung in einer bereits
1730 genannten Eisenschmelze, deren Hammerwerk von der Murg angetrieben
wurde. In den Jahren danach wurde das Werk um ein Wirtschaftsgebäude,
ein Wohnhaus, Baracken für die Arbeiter und eine abseits gelegene
Kapelle erweitert. Der Rastatter Hofglasermeister und spätere
Hofkammerrat Anton Dürr, der 1753 das Werk gepachtet hatte,
dann auch Besitzer des Werks geworden war, verkaufte es 1769. Die
neuen Eigentümer konnten indessen trotz einiger Investitionen
den Ruin des Werks 1775 nicht verhindern. Eine neue Ausschreibung
zur Fortführung durch Markgraf Karl Friedrich, den Hauptgläubiger
der Bankrotteure, verlief ergebnislos.
In den 1780er Jahren schließlich verkaufte die Witwe des
letzten Eigentümers das ganze Anwesen an den Markgrafen.
Dieser schenkte es 1790 an seine zweite Gemahlin, die Reichsgräfin
Hochberg, die darin eine Steingeschirr- und Tiegelfabrik einrichtete.
Die Manufaktur lief so gut, dass 1808 eine von Weinbrenner geplante „Römische
Villa“ im Gartenerrichtet werden konnte. 1816 allerdings
musste das Werk wegen mangelnder Rentabilität geschlossen
werden.

Schloss Rotenfels in den 1950er Jahren
Nach ihrem Tod erbte ihr Sohn, Markgraf Wilhelm, den Besitz
und begann, hier ein landwirtschaftliches Gut einzurichten, das
als Mustergut gelten sollte. Durch Grundstückskäufe
und durch Zuwendungen des Karlsruher Hofs konnte der Besitz von
17 ha im Jahr 1790 auf 122 ha 1850 vergrößert werden.
Weinbrenner war auch hier federführend, als die Fabrikanlagen
zum Landsitz umgebaut wurden. In den ehemaligen Fabrikgebäude
wurde das Herrenhaus eingerichtet, die Brennöfen dienten,
nachdem die Kamine abgebrochen waren, als Terrasse. Das neu entstandene
Landschloss wurde 1818 bezogen, allerdings in den darauf folgenden
Jahren noch weiter ausgebaut. Besonders 1842/43 erhielt der Kernbau
noch zwei senkrecht zum Hautgebäude stehende Wirtschaftsflügel.
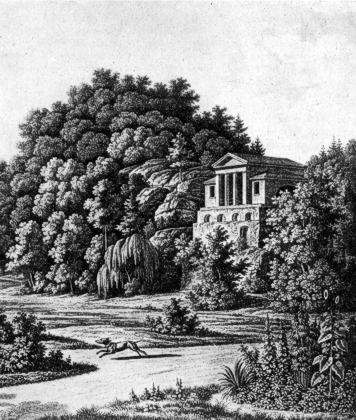
Vom Markgrafen angestellte Probegrabungen nach Steinkohle stießen
1839 auf die Mineralquelle, die bis in die 1880er Jahre für
einen kleinen Kurbetrieb im Ort sorgte. Nachdem sich Rotenfels
allrdings nicht gegen die wachsende Baden-Badener Konkurrenz
durchsetzen konnte, wurde der Kurbetrieb eingestellt und das
Kurhaus 1906 abgebrochen. 1899 war bereits das „Römische
Haus“ der Spitzhacke zum Opfer gefallen.
Der Grundbesitz war seit 1937 Staatsdomäne und an Daimler-Benz
verpachtet, die hier einen Musterbetrieb im Zusammenhang mit
der nebenan liegenden Produktionsstätte des Unimog einrichtete.
Das zwischenzeitlich privat bewohnte Schloss ist heute Heimat
der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater,
der Schlosspark ist Kurpark des Gaggenauer Stadtteils Bad Rotenfels.
Rechts: das 1899 abgebrochene "Römische Haus" |