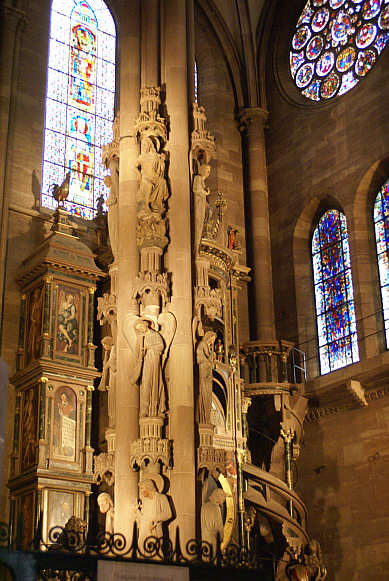
Das
Gewölbe des des südlichen Querhauses wird von einem
Säulenbündel getragen, an dem Posaunenengel das Jüngste
Gericht verkünden.
Dieses Säulenbündel stellt eine technische Revolution dar, weil die
Masse des noch im Nordquerhaus geschlossenen Trägers in einzelne schlanke
Dienste aufgelöst und der Zwischenraum zwischen den einzelnen Diensten zur
Anbringung des großartigen Figurenzyklus genutzt ist.
An der Balustrade dahinter (links außerhalb des Bildes) wartet der Überlieferung
nach ein misstrauischer Zeitgenosse des Baumeisters bis zum heutigen Tag, dass
der Pfeiler einstürzt (Figur des 15. Jahrhunderts).
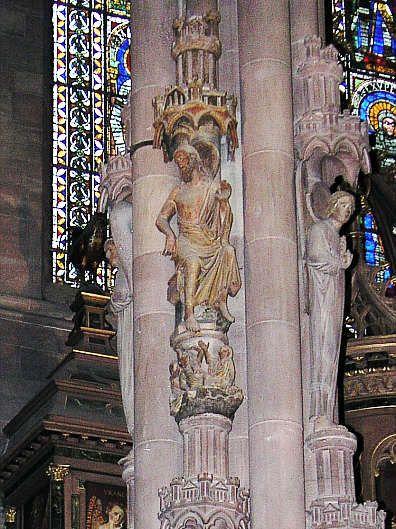
Christus
thront nicht als majestätischer Weltenrichter, wie noch
in den Bildprogrammen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts üblich,
sondern folgt eher der Gestaltung des "Schmerzensmannes", die
dann erst im 14. und 15. Jahrhundert üblich wird. Die seltsam
verdrehte Haltung, die in der Kunstgeschichte oft Anlaß zur
Kritik an der Ausarbeitung des Figurenprogramms gab, erklärt
sich daraus, dass er nicht segnet (linke Hand erhoben!), sondern
seine Wundmale zeigt. Außerdem blickt er - ungewöhnlich
für die damalige Zeit - konkret in den Raum des Kirchenschiffes
hinunter: Die Figur ist für den eintretenden Gläubigen
nicht sofort zu sehen, sondern sie ist so angebracht, dass sie
ihren Blick auf den damals vorhandenen Kreuzaltar der Gemeinde
richtete.
Damit folgt der leidende Christus des Engelspfeilers
einem neuen Ideal, das wohl durch franziskanische Vermittlung
zwischen 1223 und 1226 nach Strassburg kam. Seine Haltung entspricht
auch der Zeile aus dem "Dies irae", das im franziskanischen Umkreis
entstanden ist: "Quaerens me sedisti lassus" - "Mich suchend
saßest du erschöpft". Das Zeigen der Wundmale ist
das eigentliche Thema dieser Figur, die Wundmale waren dementsprechend
farbig ausgelegt.
Literatur: Der Christus am Strassburger Engelspfeiler. Ein
frühes franziskanisches Denkmal. Neue Zürcher Zeitung,
11. April 1998
|